Coworking für Gene
Verschiedene Ebenen der Gen-Steuerung erlauben es, neue Informationen flexibel ins Erbgut einzubauen
Gene und ihre genetischen Schalter sind in funktionellen Einheiten organisiert, um sie je nach Bedarf an- oder auszuschalten. Eine Störung dieser Strukturen kann zu Krankheiten führen. Eine neue Studie macht nun jedoch deutlich, dass diese Einheiten robuster und flexibler sind als bisher angenommen: Ein internationales Forschungsteam fand heraus, dass ein Gen auch dann noch funktionieren kann, wenn neue DNA-Abschnitte in dieselbe genomische Organisationseinheit eingefügt werden.
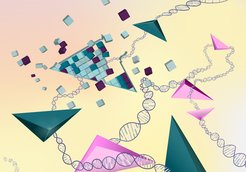
Ganze zwei Meter DNA befinden sich in dem winzigen Zellkern jeder menschlichen Zelle. Um die Zelle zur richtigen Zeit mit den richtigen Informationen zu versorgen, bündelt das langgestreckte Molekül einzelne Abschnitte und teilt sich so in funktionelle Einheiten auf: Damit befinden sich ein Gen und seine Steuersequenz im selben Arbeitsbereich. Aber was passiert, wenn diese Einheiten im Laufe der Evolution durcheinander geraten? Oder wenn das im Genom eines Patienten geschieht?
„Einige der genomischen Veränderungen, die wir in der Klinik sehen, verursachen Krankheiten, andere jedoch nicht“, sagt Stefan Mundlos von der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der auch die Forschungsgruppe Entwicklung und Krankheit am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik (MPIMG) leitet. „Wir können noch nicht vollständig erklären, warum das so ist.“
Vermeintliche Konflikte bei der Regulation von Genen sind normal und treten häufig im Genom auf. Erste Hinweise darauf, wie diese Konflikte gelöst werden, gibt eine neue Studie in der Fachzeitschrift Cell. Mundlos' Forschungsteam untersuchte darin einen Fall, in dem ein neues Gen während der Evolution erfolgreich in das Genom integriert wurde, ohne dass dabei die bereits bestehenden Kontrollmechanismen der Nachbargene gestört wurden. Davon ließe sich auch auf ähnliche Szenarien in den Zellen von Patienten zurückschließen, hoffte das Team.
Die Forscherinnen und Forscher untersuchten eine Mutation, die bei dem evolutionären Vorfahren aller Säugetiere mit Plazenta auftrat. Zu dieser Gruppe an Tieren gehört auch der Mensch, nicht aber Beuteltiere wie das Opossum. Durch die Mutation wurde das neue Gen Zfp42 direkt in den Arbeitsbereich des wichtigen Entwicklungsgens Fat1eingefügt, das für das Wachstum und die Mobilität von Zellen sorgt.
„Wir haben herausgefunden, dass Zellen mit zwei verschiedenen Mechanismen mit dem ungebetenen genetischen Gast fertig werden – abhängig davon, in welcher Situation die jeweiligen Gene gebraucht werden“, sagt Michael Robson, der das Forschungsprojekt leitete. „In bestimmten Geweben wird das neue Gen epigenetisch stillgelegt, also vollständig abgeschaltet. Aber in frühen Entwicklungsphasen des Embryos sind beide Gene aktiv. Dann baut die Zelle diesen Teil des Genoms zu völlig neuen Funktionseinheiten um, die ihre individuelle Kontrolle ermöglichen."
Ein Neuer im Büro
Robson, seine Doktorandin Alessa Ringel und ihre Kolleg*innen untersuchten die Arbeitsumgebung des Fat1-Gens, das wie viele andere Gene auch von anderen DNA-Sequenzen, sogenannten Enhancern, gesteuert wird. Damit Enhancer und Gen miteinander kommunizieren können, krümmt und biegt sich das DNA-Molekül, um sie so in einem geschützten Arbeitsbereich zusammenzubringen. Diese funktionellen Arbeitseinheiten der DNA werden topologisch assoziierte Domänen (TADs) genannt.
Hühner und Opossums sind keine plazentalen Säugetiere – bei Ihnen befindet sich nur das Gen Fat1 in derselben TAD-Einheit wie sein Enhancer. Das Erbgut knäult sich an dieser Stelle zusammen, sodass sich beide Gensequenzen berühren, wodurch Fat1 aktiviert wird. Das überprüften die Forschenden mit der „Hi-C“-Methode, die misst, wie häufig sich welche Teile der DNA nahekommen.
„Aber bei Säugetieren mit Plazenta wie beispielsweise Mäusen oder Menschen ist es etwas komplizierter“, erklärt Ringel, die Erstautorin der Publikation. Weil sich beide Gene eine TAD teilen, müssten sie von demselben Enhancer kontrolliert werden, was nicht der Fall ist. „Beide Gene kommen miteinander gut klar – sie sind voneinander unabhängig und werden in verschiedenen Geweben zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Entwicklung aktiv.“
Entweder schlafen legen oder den Arbeitsplatz umbauen
Um der Frage auf den Grund zu gehen, wie sich die Gene aus dem Wege gehen, untersuchten die Forschenden Zellen aus verschiedenen Geweben der Maus: die sich entwickelnden embryonalen Gliedmaßen sowie embryonale Stammzellen.

Demnach kontaktiert der Enhancer in den Gliedmaßen tatsächlich beide Gene, Zfp42 bleibt davon jedoch unbeeindruckt. Tatsächlich befindet sich „der Neue“ immer noch im selben Arbeitsbereich, schläft aber still in einer Ecke.
Denn die Zelle hat das Gen durch DNA-Methylierung ruhiggestellt, eine chemische Modifikation, die DNA-Abschnitte in einen deaktivierten Zustand versetzt. Das klappt aber nur, wenn sich Zfp42 an genau der richtigen Stelle der TAD befindet. Sobald es gentechnisch nur ein bisschen nach links oder rechts verschoben wurde, wurde es durch den Enhancer des Fat1-Gens aktiviert.
In den embryonalen Stammzellen bot sich den Wissenschaftler*innen dagegen ein völlig anderes Bild. Hier ist die DNA um die beiden Gene herum offenbar völlig anders organisiert. Zfp42 und Fat1 bauen dort ihre eigenen, räumlich getrennten Arbeitsbereiche mit ihren jeweiligen Enhancern auf. Hi-C-Experimente, hochauflösende Mikroskopie und Computersimulationen zeigten, dass die ursprüngliche TAD in kleinere DNA-Blöcke aufgeteilt wurde, um die beiden Gene zu trennen.
Ein robustes und flexibles System der Gensteuerung
Ein einziger DNA-Arbeitsbereich kann also mit leichten Modifikationen ganz unterschiedliche genetische Funktionen gleichzeitig beherbergen. Dass dies durch zwei verschiedene Prozesse stattfindet, konnte das Team nun erstmals nachweisen.
„Wie sich verschiedene Ebenen der genetischen Steuerung gegenseitig ergänzen ist immer wieder spannend zu untersuchen“, sagt Ringel. „Besonders überrascht hat uns aber, wie dynamisch das Genom in verschiedenen Situationen reagieren kann, um eine präzise Genregulation sicherzustellen. TADs könnte man demnach vielleicht weniger als starre, sondern eher als flexible DNA-Strukturen bezeichnen.“
Trotzdem ist die TAD-Struktur des Fat1-Gens über hunderte von Millionen Jahren der Evolution nicht ohne Grund fast unverändert geblieben – von Fischen und Fröschen bis hin zu Beuteltieren – sagt Projektleiter Robson. „Auf den ersten Blick erscheinen TAD-Arbeitsbereiche recht empfindlich, denn es geht häufig einiges schief, wenn man sie verändert“, sagt er. „Aber wenn neue Gene entstehen, müssen diese irgendwo hin. Wir zeigen, wie die Evolution die regulatorischen Domänen verändern kann, um neue Gene und Funktionen auf sichere Art und Weise hinzuzufügen.“
„Interessanterweise spiegelt dieses evolutionäre Geschehen das wider, was wir oft bei Patienten mit extremen genomischen Veränderungen sehen“, sagt Mundlos. „Bei Chromothripsis zum Beispiel können die Chromosomen in viele Stücke zersplittert sein, aber dennoch beobachten wir nur relativ leichte Symptome. Möglicherweise nutzt die Zelle die bereits vorhandenen Regulationsmechanismen, um schädliche Effekte auszugleichen.“













